Bild (c) ap, FA KW
Es sei vorangestellt, dass der Autor dieser Zeilen kein
unkritischer Anhänger der Theorie ist, dass die Geschlechtsidentität eines
Menschen ausschließlich kulturell beeinflusst wird. Ebenso wenig glaube ich
daran, die unbestreitbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern
ausschließlich biologisch erklären zu können. Die Wahrheit liegt, wie so oft,
irgendwo dazwischen. Fest steht jedoch, dass Gesellschaften sich schwer tun,
einmal festgefahrene Strukturen und Denkmodelle zu verlassen oder sie zumindest
aufzubrechen. Der Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest 2014 ist gerade deshalb bemerkenswert, weil
man eine „Provokation“ gewürdigt hat.
Die Kinokette cinemaxx
bietet turnusmäßig die sogenannte Ladies
Night bzw.den Männerabend an. Bei
ersterem gibt es zum Film eine Flasche Sekt und eine Ausgabe der Zeitschrift Gala dazu, bei letzterem ein Bier und
ein Playboy-Magazin. Für die Frauen
werden meist die neusten „romantic comedys“ gezeigt, die Männer werden oft mit Actionfilmen
abgespeist. Das ganze Konzept ist angelegt als Klischee, als unhinterfragte
Weiterschreibung von geschlechtlichen Stereotypen. Nun ist nichts gegen Frauen
zu sagen, die bei einer seichten Komödie entspannt einen Sekt schlürfen oder
Männern, die ihr Bier im Beisein von generischen Explosionen genießen wollen,
es ist vielmehr die Ausschließlichkeit, die Festlegung auf ein vermeintlich
zutreffendes Bild von Männern und Frauen, das aufstößt.
Wäre das Kino das einzige Reservat, in dem diese archaischen Zuschreibungen einmal die Woche noch greifen würden, wäre vermutlich nichts dagegen zu sagen, es wäre ein putziges Spiel mit längst überwunden geglaubten, betonartigen Zuschreibungen. Doch dem ist nicht so, alles hängt zumindest latent noch einer festen Rollenzuschreibung nach. Frauen mit eigenen Meinungen irritieren die Männer, Männer, die nicht dem Bild eines ständig nach Fleisch schmachtenden Fußballfans entsprechen werden argwöhnisch beobachtet – oftmals von beiden Geschlechtern. Es sind überkommende Ideen, die in den Köpfen herum spuken und unsere Gesellschaft braucht auch noch um 21. Jahrhundert eine Figur wie Conchita Wurst, hebt sie die als sicher geltenden Geschlechtsschranken doch vollkommen auf.
Selbstredend ist das Konzept nicht neu, weder das der
Travestie noch des schrillen, durchaus provokativen Auftretens (wobei Conchita
augenscheinlich nur durch ihre bloße Existenz bereits provoziert). Doch es ist
ein Unterschied, wenn sich die Gesellschaft zur besten Sendezeit mit etwas
auseinandersetzen muss, was sonst nur in bewusst gewählten Zirkeln geschieht.
„Conchita Wursts Auftritt beim ESC ist Körperpolitik nicht an der Uni, sondern im Mainstream.“, bemerkt Mithu Sanyal für WDR 5 sehr treffend und fügt nüchtern hinzu: „Und da gehört sie auch hin.“[1]
„Conchita Wursts Auftritt beim ESC ist Körperpolitik nicht an der Uni, sondern im Mainstream.“, bemerkt Mithu Sanyal für WDR 5 sehr treffend und fügt nüchtern hinzu: „Und da gehört sie auch hin.“[1]
So macht auch der opulente Auftritt Sinn, steht er doch in direkter Tradition der Travestie – und weniger in der eines James-Bond-Intros. Conchita hat 150 Millionen Zuschauern deutlich vor Augen geführt, dass es mit der vollkommen eindeutigen Geschlechtszuschreibung so eine Sache ist. Tom Neuwirth, die Person hinter Conchita, hat unzweifelhaft eine Kunstfigur im besten Sinne geschaffen, weder Mann noch Frau – sondern uneindeutig, schlicht menschlich. Wer sich daran stört, womöglich sogar in der eigenen Sexualität oder Neuwirth zum Psychotherapeuten schicken möchte wie unlängst der Entertainer Alf Poier[2], der demonstriert damit nur ein Unbehagen, dass zu lange in der als sicher geltenden Definitionsdecke von Geschlechtlichkeit eingerollt war. Einer freiheitlichen Gesellschaft, die überkommende alte Zöpfe abschneiden will und sollte, gereicht dies nicht zur Ehre.
So ist der Sieg Conchitas natürlich auch ein politisches
Statement, aber eben eins, dass als gesellschaftlicher Gradmesser fungieren
kann. Der „Westen“ positioniert sich dadurch klar als Opposition zum „Osten“,
der in der angespannten politischen Lage getrost mit Russland gleichgesetzt
werden kann. So sind die Buh-Rufe, wann immer Russland für ein reichlich
schlechtes Lied und eine schwache Performance eine hohe Punktezahl einfahren
durfte, zwar nicht sonderlich sportlich, von einem rein emotionalen Standpunkt
aber erklärbar. Natürlich ist dies ein irritierender Rückfall in Zeiten des
Kalten Krieges und natürlich sind Situationen wie die Ukrainekrise komplexer
als simple Schwarz/Weiß-Malerei, aber der ESC ist kaum eine Bühne zur tiefergehenden
politischen Diskussion. Es regiert das emotionale Moment und dies hat sich am
letzten Samstag in einem spontanen Bekenntnis zum Progressiven entladen. Selbst
wenn man nicht so weit gehen möchte, ist die Diskussion nun entbrannt und womöglich
denken nun mehr Menschen über das Konstrukt Geschlecht nach – es verletzt
niemanden und verwandelt heterosexuelle Menschen auch nicht reihenweise in Homosexuelle.
So sind die ätzenden Kommentare, die von russischen Politikern kommen, kaum mehr
als verzweifelte Realsatire: Wenn man Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg
besetzt gehalten hätte, dann wäre so etwas nie passiert.[3]
Eine Gesellschaft wird erst dann das Höchstmaß an
Entwicklung erreicht haben, wenn ein Mensch wie Conchita auch nicht mehr
Aufmerksamkeit erregt als jeder andere Teilnehmer einer Veranstaltung wie des
ESC. Bis dahin sind die als Seismograph, Statement und Kampfansage gegen
sinnlos-tradierte Rollenbilder unerlässlich.
[1] Mithu
Sanyal: Barbiepuppe mit Bart:
http://www.wdr5.de/sendungen/politikum/kommentar/conchitawurst100.html(aufgerufen am 12.05.2014)
[2] Tiroler
Tageszeitung Online: Song Contest 2014 –
Poier über Wurst: „Verschwulte Zumpferl-Romantik“:
[3] RP
Online: Russische Politiker schimpfen auf
Conchita Wurst:
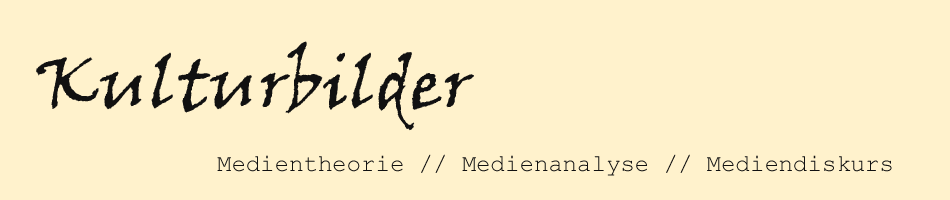

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen